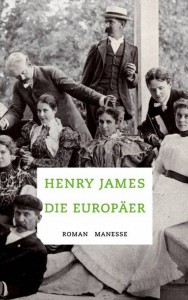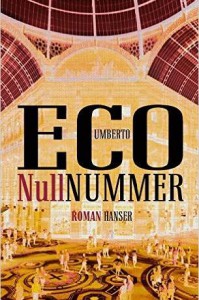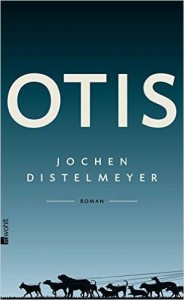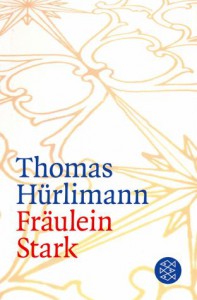Am 9. Juni 2020 gedenken wir des 150. Todestages des viktorianischen Schriftstellers Charles Dickens. Das ist ein guter Anlass, auf diesem Blog die Reihe zu seinem Werk fortzuführen. Ich hatte in der Vergangenheit, vor allem 2012 zum 200. Geburtstag von Dickens, Beiträge zu Dombey und Sohn (Dombey and Son), zu Harte Zeiten (Hard Times), zu Unser gemeinsamer Freund (Our Mutual Friend) und zur Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol) veröffentlicht. Auch habe ich Fachartikel zu Edwin Drood geschrieben (als Teil meiner Monografie Vision and Character), zu Dickens‘ Kurzgeschichte „Hunted Down“ (veröffentlicht in Dickens Studies Annual 48) und zu seinen journalistischen Beiträgen als „Uncommercial Traveller“ (in dem Sammelband Palimpsestraum Stadt) (tut mir etwas Gutes und empfehlt diese Bücher den Bibliothekar*innen Eures Vertrauens!). Auch habe ich viel Dickens an der Uni unterrichten und auf der Jahrestagung der Dickens Society 2018 über Dickens vortragen dürfen. Kurz: Dickens begleitet mich weiterhin in meinem Alltag und in meinem Berufsleben, so dass ich dachte, es sei mal wieder an der Zeit, zu ihm zu schreiben und an die o.g. Reihe anzuknüpfen. Genauer: An Die Weihnachtsgeschichte, die zu den berühmtesten Werken des Autors zählt. Kein Wunder also, dass der Text vielfach verfilmt wurde und die Entstehungsgeschichte von A Christmas Carol selbst sogar Gegenstand eines Films geworden ist: The Man Who Invented Christmas. Eine Künstlerkomödie für die ganze Familie, was zum Lachen, was zum Weinen, und jede Menge Anspielungen für Dickens-Fans.
Am 9. Juni 2020 gedenken wir des 150. Todestages des viktorianischen Schriftstellers Charles Dickens. Das ist ein guter Anlass, auf diesem Blog die Reihe zu seinem Werk fortzuführen. Ich hatte in der Vergangenheit, vor allem 2012 zum 200. Geburtstag von Dickens, Beiträge zu Dombey und Sohn (Dombey and Son), zu Harte Zeiten (Hard Times), zu Unser gemeinsamer Freund (Our Mutual Friend) und zur Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol) veröffentlicht. Auch habe ich Fachartikel zu Edwin Drood geschrieben (als Teil meiner Monografie Vision and Character), zu Dickens‘ Kurzgeschichte „Hunted Down“ (veröffentlicht in Dickens Studies Annual 48) und zu seinen journalistischen Beiträgen als „Uncommercial Traveller“ (in dem Sammelband Palimpsestraum Stadt) (tut mir etwas Gutes und empfehlt diese Bücher den Bibliothekar*innen Eures Vertrauens!). Auch habe ich viel Dickens an der Uni unterrichten und auf der Jahrestagung der Dickens Society 2018 über Dickens vortragen dürfen. Kurz: Dickens begleitet mich weiterhin in meinem Alltag und in meinem Berufsleben, so dass ich dachte, es sei mal wieder an der Zeit, zu ihm zu schreiben und an die o.g. Reihe anzuknüpfen. Genauer: An Die Weihnachtsgeschichte, die zu den berühmtesten Werken des Autors zählt. Kein Wunder also, dass der Text vielfach verfilmt wurde und die Entstehungsgeschichte von A Christmas Carol selbst sogar Gegenstand eines Films geworden ist: The Man Who Invented Christmas. Eine Künstlerkomödie für die ganze Familie, was zum Lachen, was zum Weinen, und jede Menge Anspielungen für Dickens-Fans.
Literatur hören
Uns folgen:
Blogroll
Kategorien
Tag Cloud
-
Neueste Beiträge
- Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand (The Man Who Invented Christmas) (Regie: Bharat Nalluri, 2017)
- Hans Scherfig: Der verschwundene Kanzleirat (1938) – Welche Unfreiheit hätten Sie denn gerne?
- W. Somerset Maugham: Ashenden oder Der britische Geheimagent (1928)
- Alain Badiou: Versuch die Jugend zu verderben (2016)
- Neues Geld und alter Adel: Henry James, Die Europäer (Neuübersetzung von Andrea Ott)
Neueste Kommentare
- ekron bei Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand (The Man Who Invented Christmas) (Regie: Bharat Nalluri, 2017)
- Elisabeth Nölting bei Literaturverfilmungen: Viktorianische Romane
- Barbara Feldbacher bei Hat Shakespeare seine Stücke selbst geschrieben?
- Daniel bei Iphigenie auf Tauris: Zusammenfassung (Euripides)
- Miss Hastings bei Charlotte Brontë, Villette (1853) – Inhaltsangabe und Erläuterung
- Ilka bei Literaturverfilmungen: Viktorianische Romane
- Olaf Krebs bei Theodor Fontane: Unterm Birnbaum (1885) – Interpretation und Erläuterung
- W. Mittag bei Theodor Fontane: Unterm Birnbaum (1885) – Interpretation und Erläuterung
- Herbert bei George Eliot, Middlemarch (Inhaltsangabe)
- jhdb bei William Shakespeare, The Tempest, Interpretation
Archive
- März 2020
- Juni 2018
- Januar 2017
- Dezember 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- August 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Oktober 2014
- September 2014
- Juli 2014
- Oktober 2013
- September 2013
- Dezember 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Februar 2010
- Januar 2010
- Dezember 2009
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- April 2009
- Januar 2009